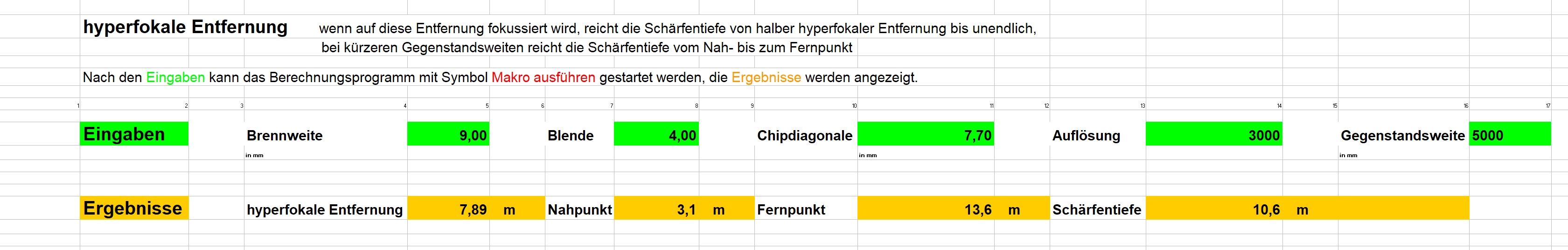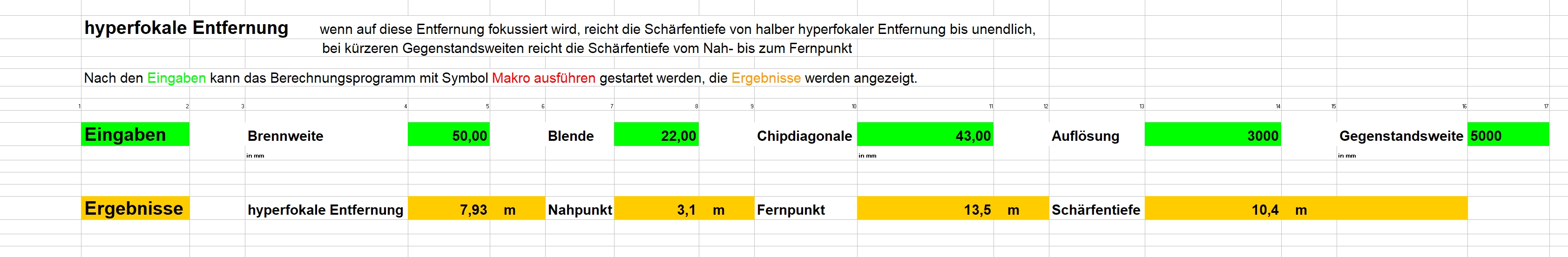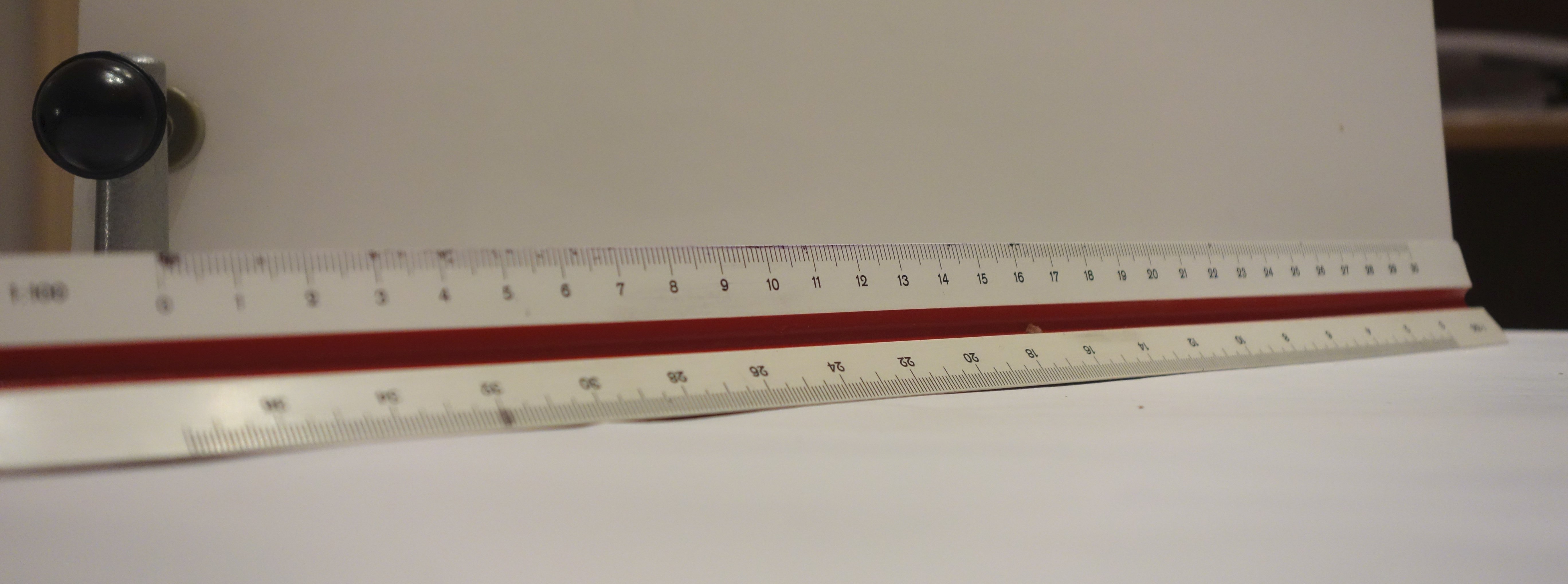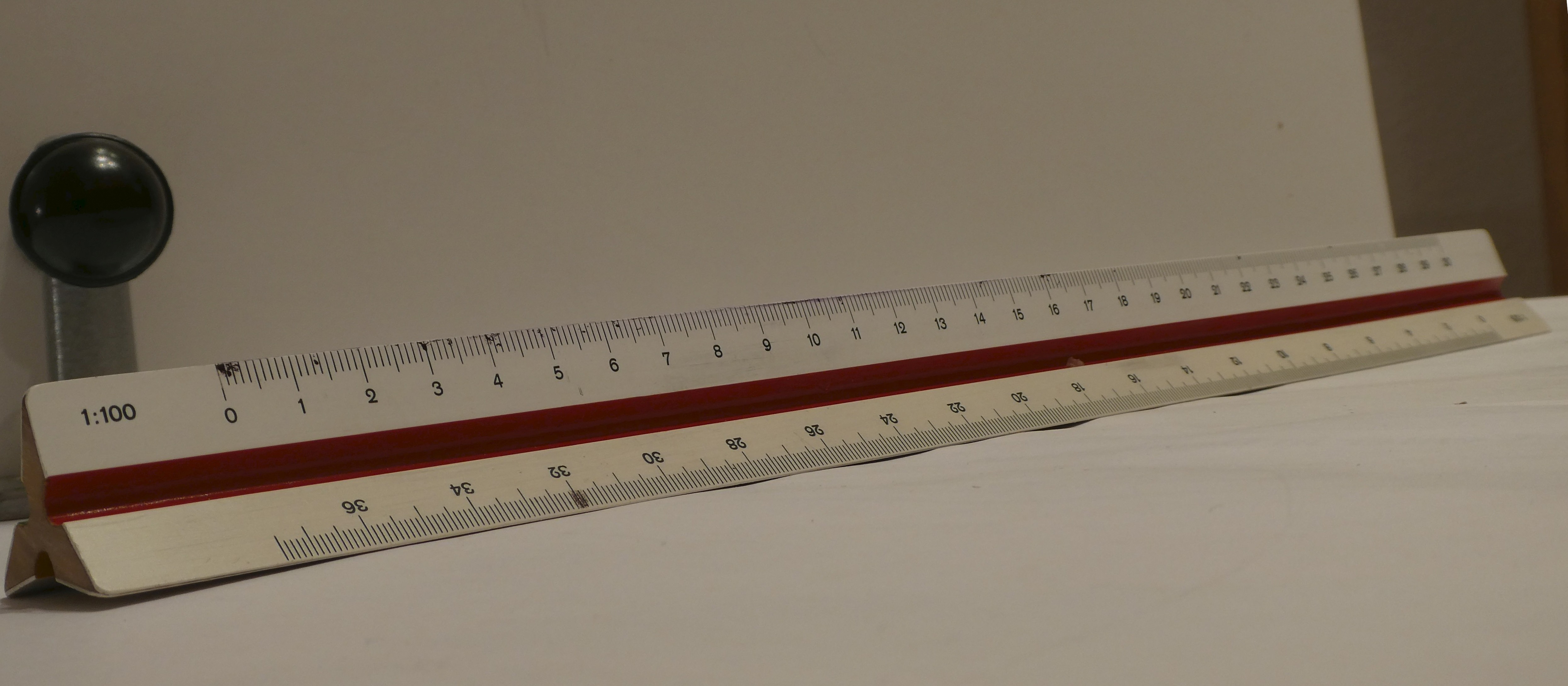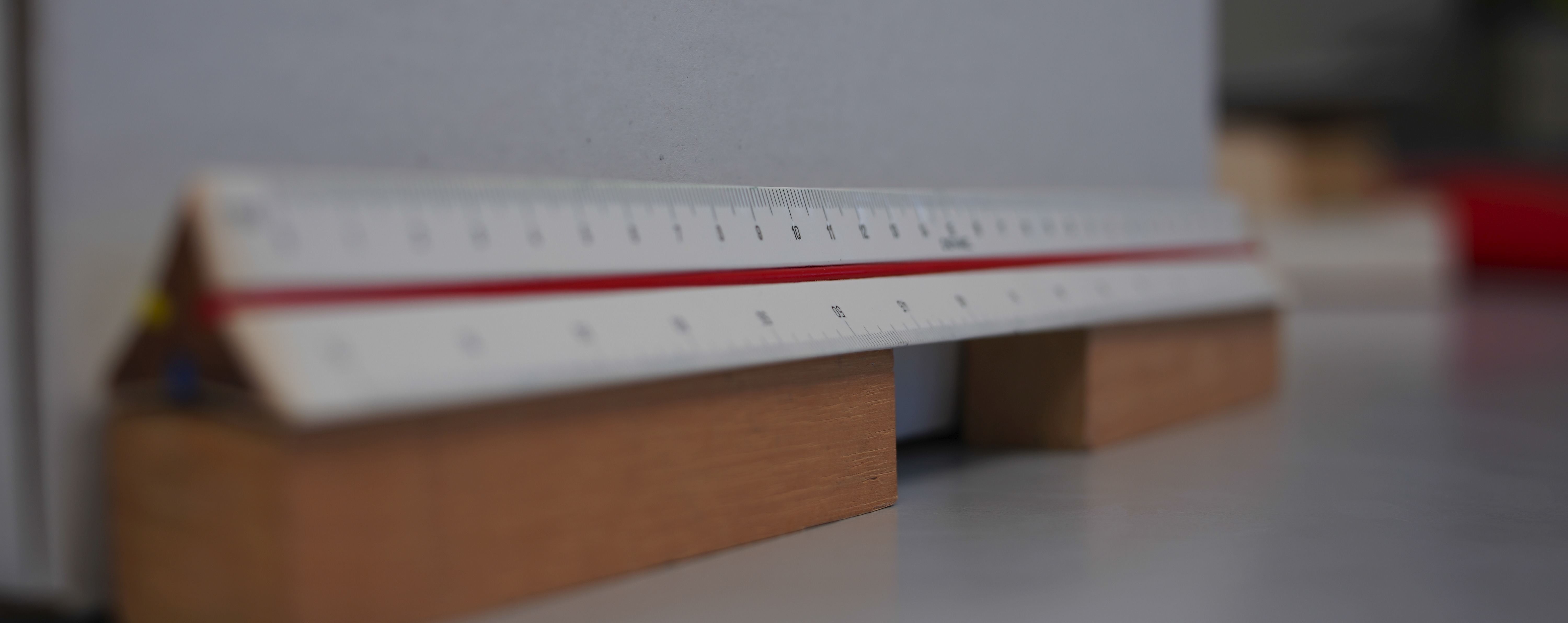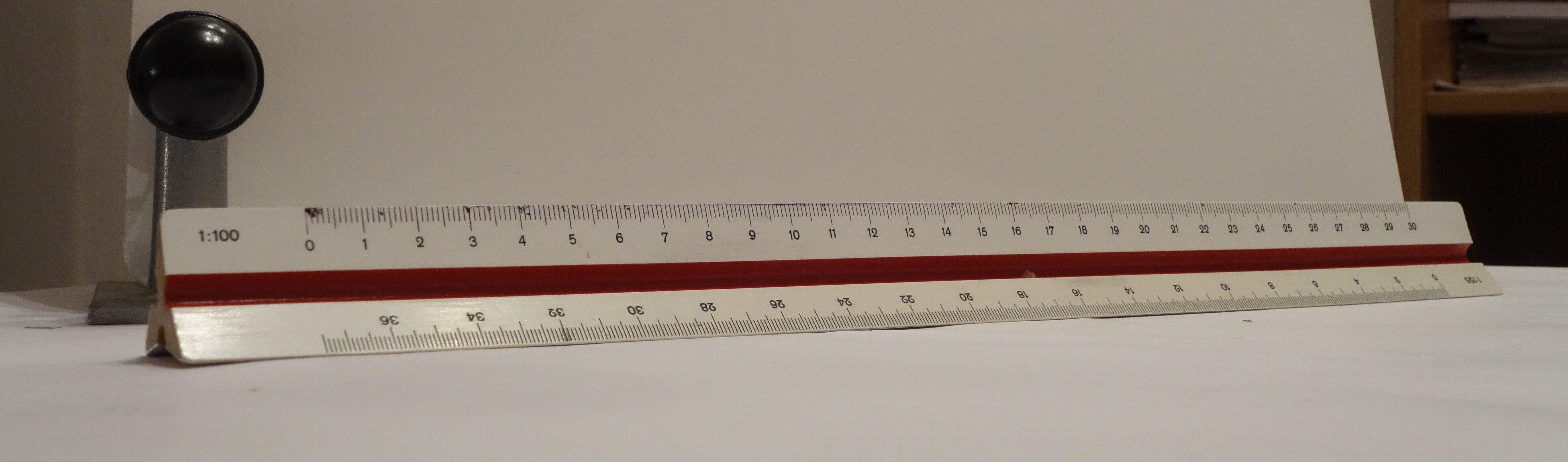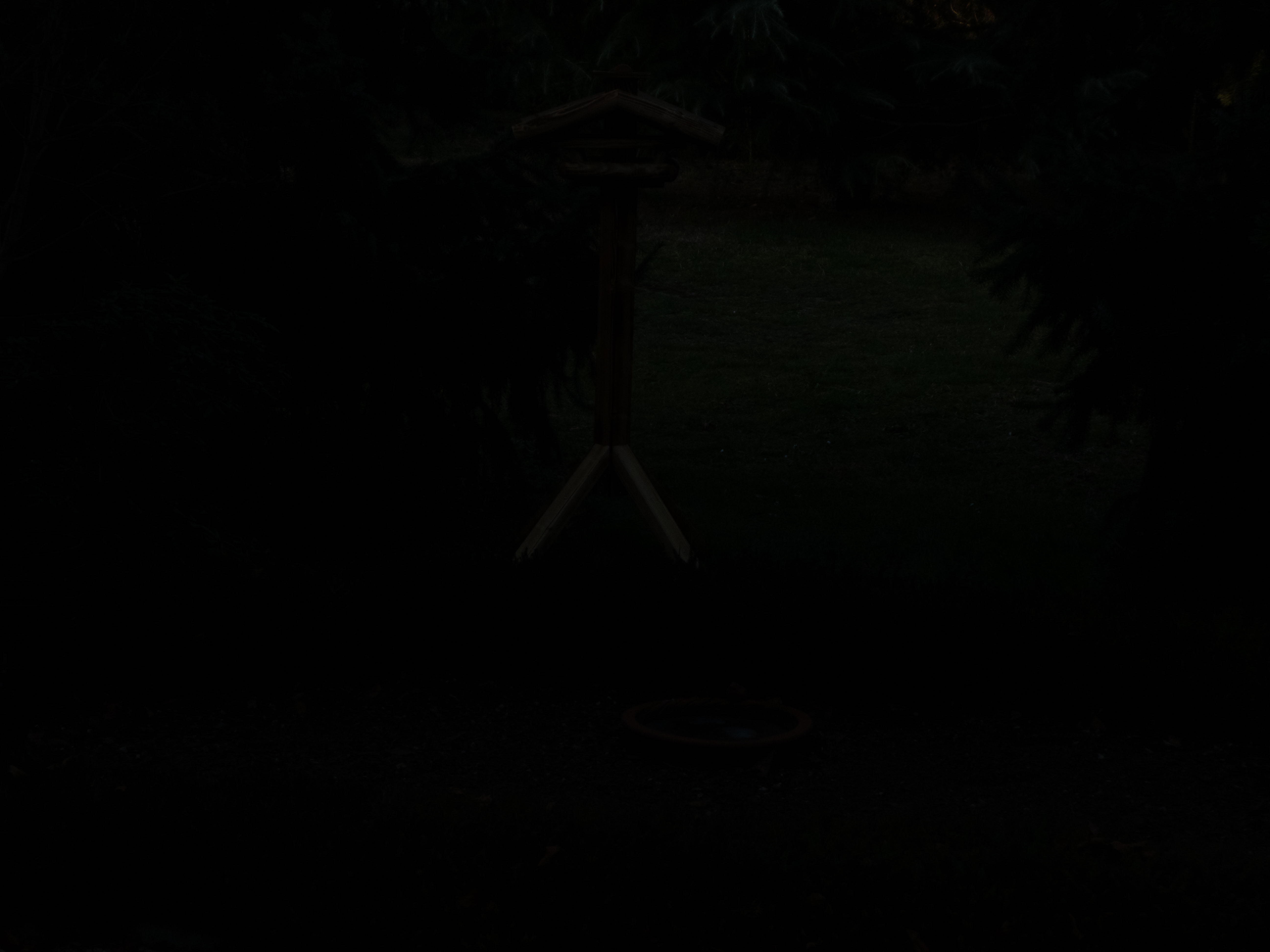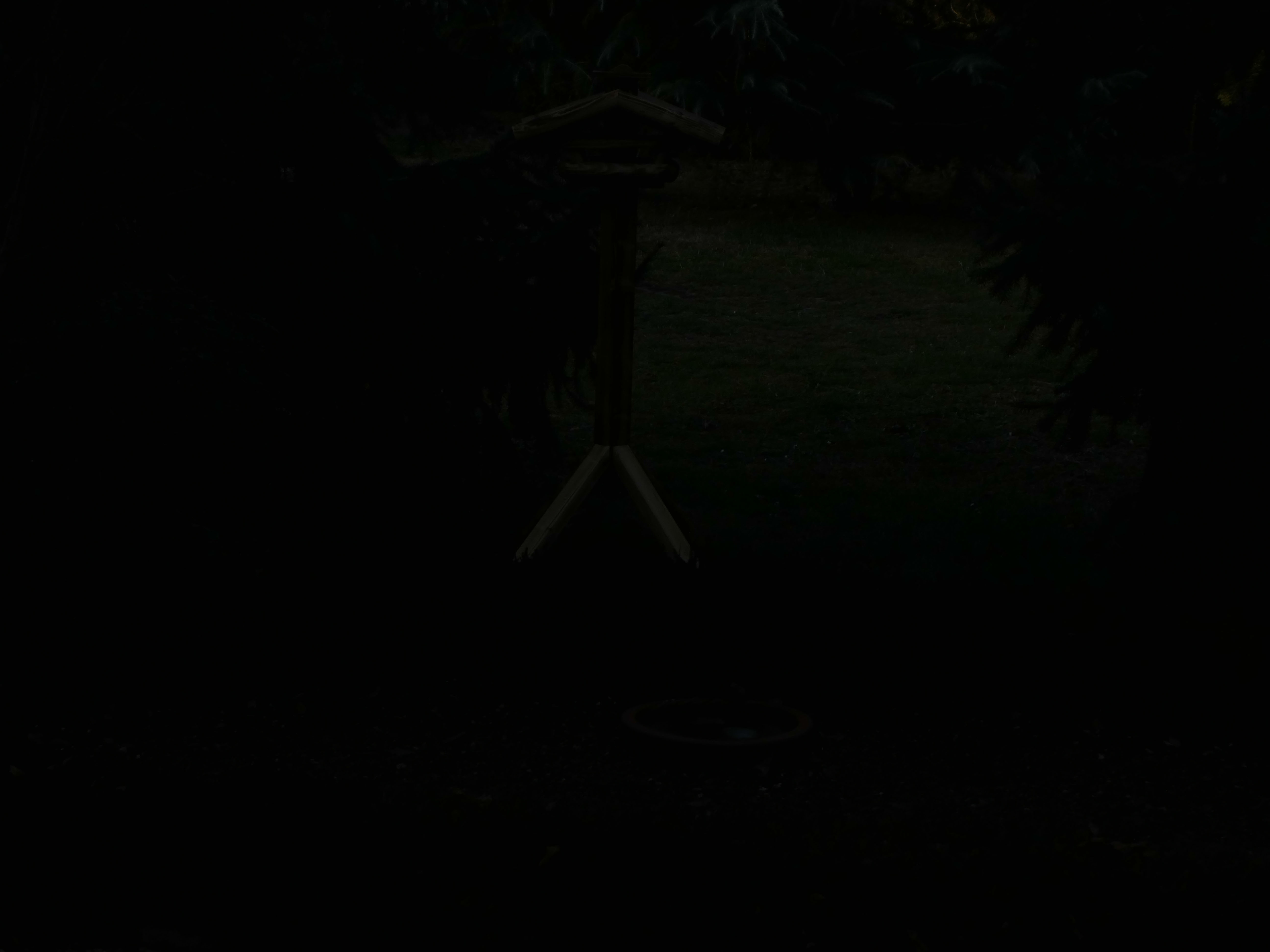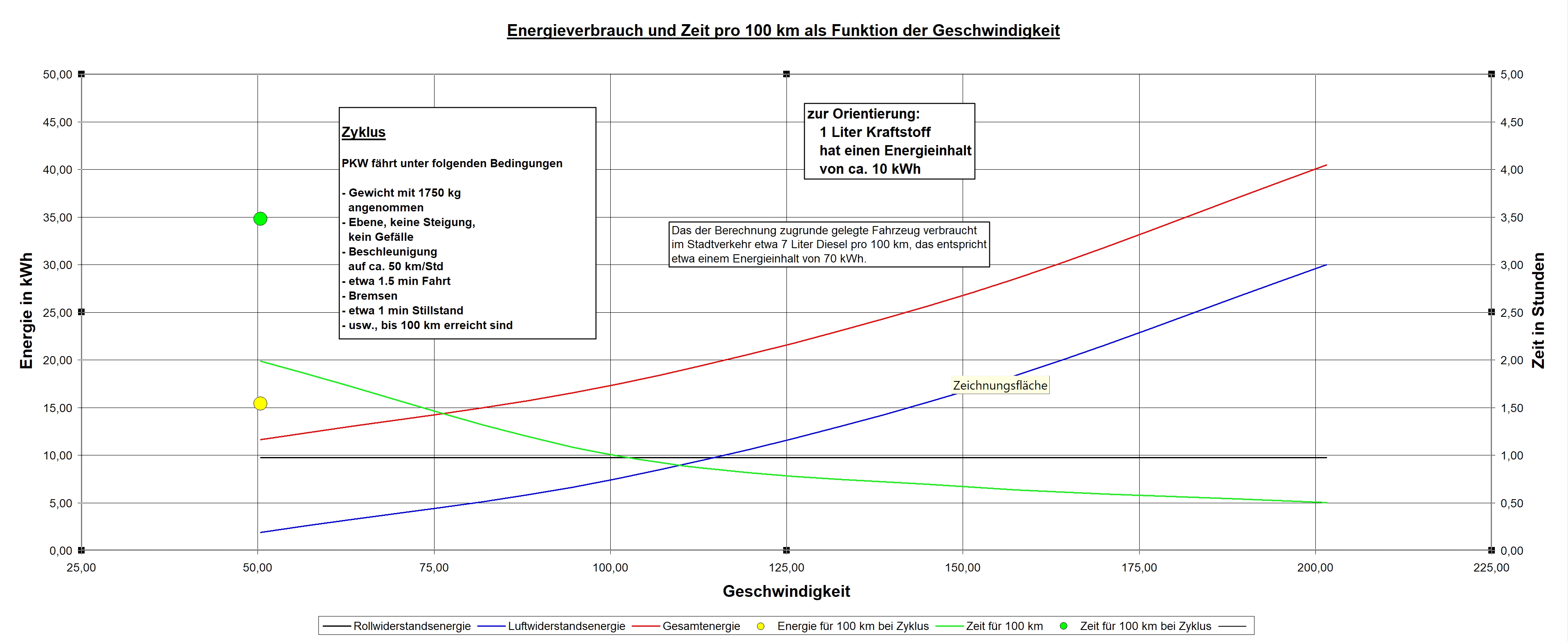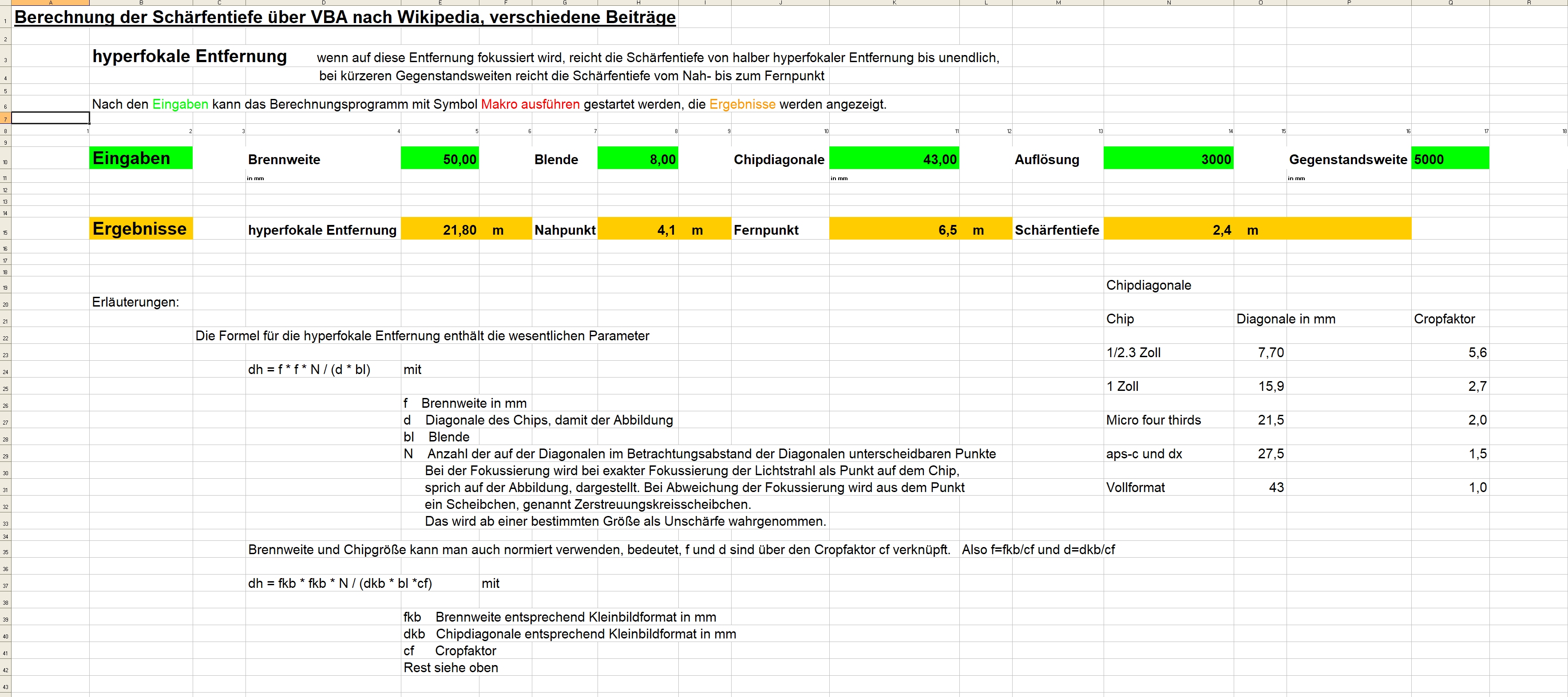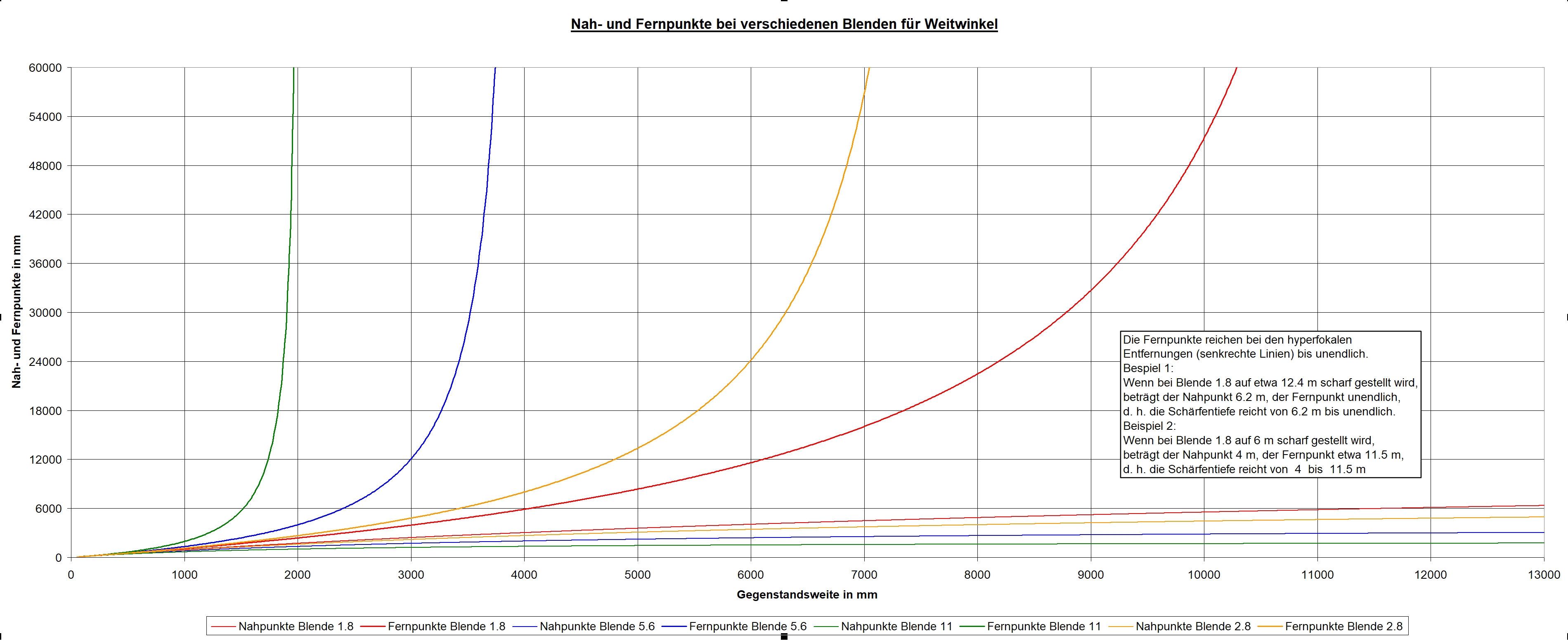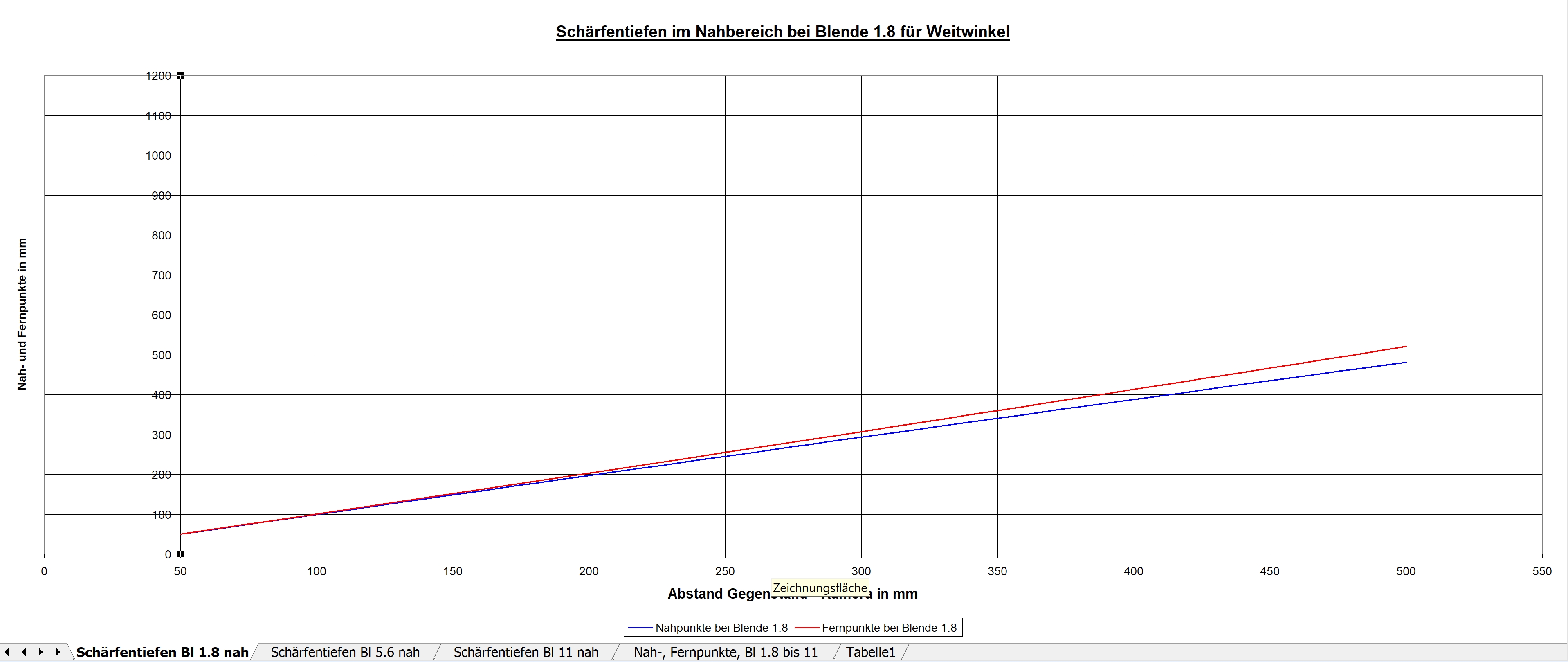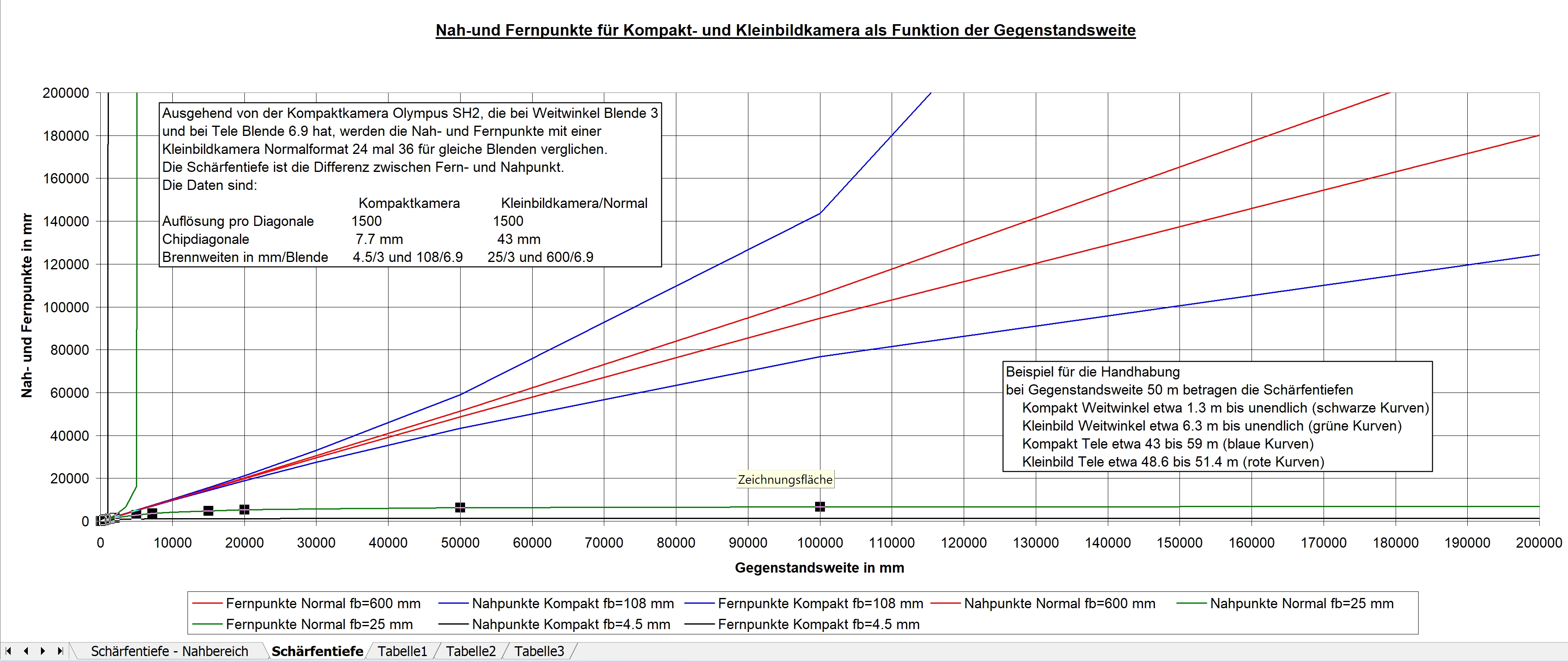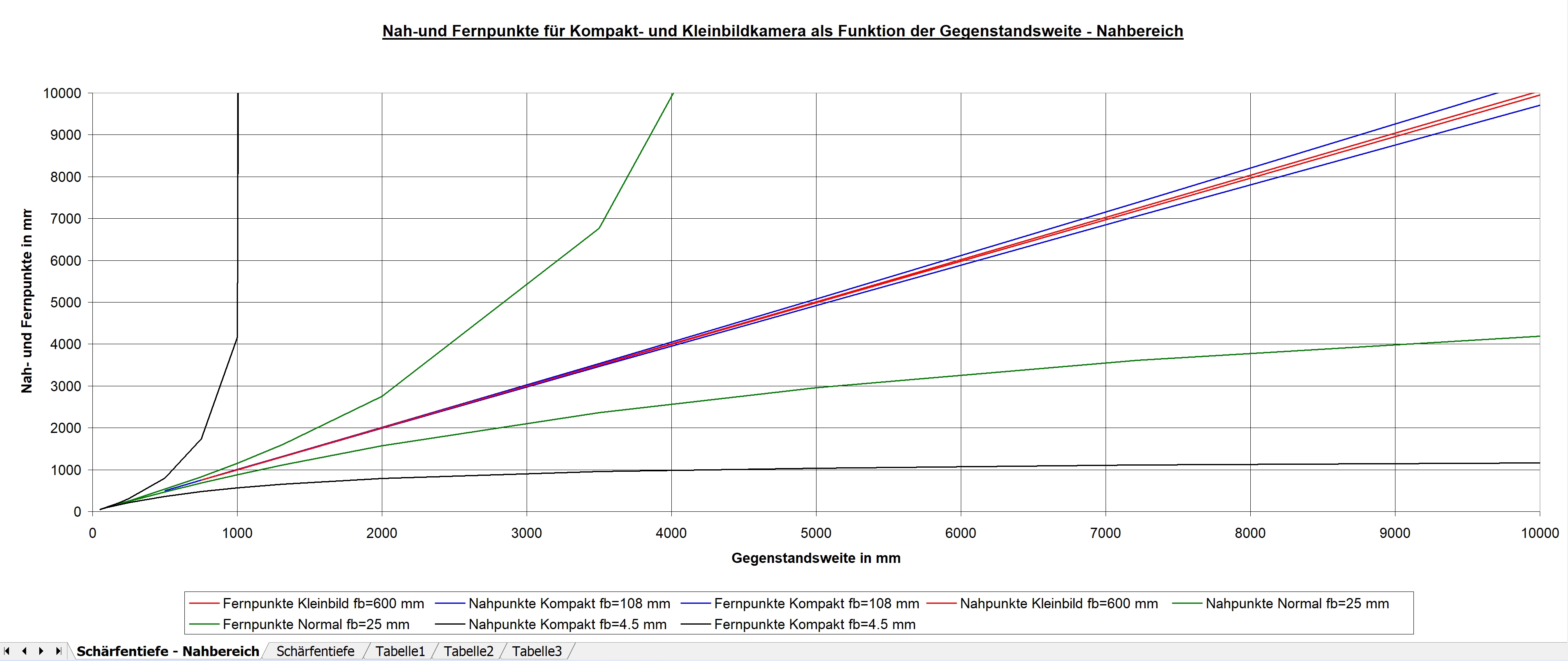Da das Bildbearbeitungsprogramm Capture One, im Folgenden C1, neuerdings recht stark beworben wird und als mögliche Alternative für die Abonnementversionen von Adobe mit ihren Problemen insbesondere für Hobbyfotografen interessant ist, habe ich die Testversion Capture One Pro Version 12 installiert und habe diese erprobt.
Ich arbeite mich im Allgemeinen intuitiv in neue Programme ein, das fällt mir bei diesem Programm schwer.
Total belastend finde ich, daß ich regelrecht belästigt werde mit Katalogordnern und Sitzungsordnern, selbst wenn ich programmeigene Ordnungssysteme gar nicht nutzen möchte.
Besonders störend finde ich, daß dieses aufdringliche Verhalten auch noch Spuren hinterläßt, die ich mühselig wieder beseitigen muß. Es werden Ordner angelegt, wo Capture One an sich nichts zu suchen hat.
Bei Capture One ist das Öffnen eines Bildes sehr umständlich, für mich nicht intuitiv. Ich habe zunächst eine neue Sitzung eröffnen müssen und dann in den Ordner navigieren müssen, in dem das zu öffnende Bild ist, dann erscheint das Bild auch nach einiger Zeit und es sind wieder 2 Ordner in dem Verzeichnis von C1 generiert worden, die ich wieder löschen muß, weil ich sie nicht benötige.
Sicher kann man sich an Vieles gewöhnen, aber der erste Eindruck ist diesbezüglich nicht gut.
Wenn ich das Programm Capture One nur als Bildbearbeitungsprogramm einschließlich Raw-Converter nutzen will, ist es für mich umständlich zu handhaben und total überladen.
Da ich seit 2014 als Dateisystem Adobe dng nutze, begrüße ich, daß Capture One dieses Format auch unterstützt (ich habe dazu schon kurz berichtet).
Ich habe mich deshalb damit etwas näher beschäftigt.
Ausgangspunkt ist ein älteres .arw-Raw-File aus der Sony RX100.
Zunächst das Ausgangsbild

Das Bild wurde mit Capture One und mit Lightroom in dng konvertiert, wobei jeweils die Schärfung auf null gesetzt und die Helligkeit, die geringfügig unterschiedlich war, angeglichen wurde.


………………………………………………
Abgesehen von geringen Tonwertunterschieden, die ausgleichbar sind, sind keine Unterschiede zu erkennen.
Wenn ich das Bild aus C1 in jpg oder tif exportiere, sind die Tonwerte stark unterschiedlich zum in C1 angezeigten Raw-Bild und in anderen Programmen.
Das Ausgangsbild in C1 vor der Konvertierung sieht richtig aus.
Möglicherweise mache ich etwas falsch, aber wenn man mit einer Testversion wirbt, sollte so etwas nicht passieren können.


………………………………………….
Jetzt wurde das mit Lightroom generierte dng-Bild nach C1 importiert, mittelmäßig geschärft, weiter keine Bearbeitung und dann als dng-Bild exportiert. Die Tonwerte sind verändert, rot ist viel zu stark.


…………………………………………
Noch erwähnenswert ist, daß die Dateigröße der dng-Datei in Capture One bedeutend größer ist als die dng-Datei in Lightroom,
im Beispiel etwa 40 zu 24 MB.
Außerdem wird nur ein winziges jpg-Vorschaubild eingebettet, bei Lightroom kann das wahlweise auch in voller Größe eingebettet werden. Vorschaubilder in voller Größe haben den Vorteil, daß die Anzeige bei entsprechender Einstellung des Bildbetrachterprogrammes rasant schnell geht, weil das Bild fertig ist, nur aufgerufen werden muß, also nicht erst wie das dng jedesmal entwickelt werden muß.
Für mich ist ein weiterer Nachteil von Capture One, daß in sein dng scheinbar nur raw-Files eingebettet werden können.
Dann habe ich versuchsweise das C1-dng in Photoshop Elements geöffnet, geht über den Raw-Konverter, dort Bild öffnen, geöffnetes Bild in Ordnung.
Jetzt Bild geschlossen, ohne abzuspeichern, das dng wird so verändert, daß nur noch eine winzige Vorschau zu sehen ist, und es ist zu sehen, daß sich die Größe der dng-Datei etwas verändert hat, obwohl ich wie gesagt keinerlei Speicherung durchgeführt habe.
Normalerweise erwarte ich, daß ein Format dng unabhängig vom Hersteller gleich ist. Wenn ich jpg oder tif hernehme, dann gehe ich davon aus, daß die Formate unabhängig vom Hersteller gleich sind und das sind sie auch.
Beim dng-Format von Capture One und Adobe ist das nicht so.
Wenn ich die Dateien editiere und nach bestimmten Begriffen suche, z. B. die Werte der Steller, so stelle ich fest, daß es da grundlegende Unterschiede gibt.
Im Beispiel habe ich das arw-Ausgangsbild in Capture One maximal, also mit 1000, geschärft, das Ergebnis in C1 ist extrem/übertrieben scharf.
Als dng exportiert und in Lightroom geöffnet, ist das Bild nicht geschärft, und die Steller unter Details (Überschrift ist bei C1 und Lr gleich) insbesondere Stärke fürs Schärfen stehen bei null bzw. kleinen Werten. Der Wert von C1, 1000 erscheint in Lr nicht.
Weitere Suche in C1, da gibt es Exportrezept, da kann man etwas anpassen, insbesondere zur Schärfe. Ergebnis Tonwerte nach grün verschoben…
Noch zur Schärfung, die Optionen bei Capture One finde ich gut, so lange man in Capture One bleibt, sind die Ergebnisse bzgl. Schärfen und Rauschen auch gut, wobei die Schärfung bei maximalem Wert übertrieben ist.
Bei Adobe kann man zu ähnlichen Ergebnissen kommen, die Einstellungen sind anders, vielleicht etwas umständlicher, da ich aber ohnehin mit Vorgaben arbeite, spielt das keine Rolle.
Außerdem kann bei Adobe mit den Schärfentools der Nik-Collection gearbeitet werden, mit denen auch sehr gute Ergebnisse erzielt werden können.
Aus meiner Sicht bietet Capture One mit seinem dng-Format erfreulicherweise auch ein non destructives Bilddateiformat an.
Das habe ich allerdings nicht weiter getestet.
Bezüglich erreichbarer Bildqualität habe ich in meinem hierzu schon erschienenen Beitrag versucht nachzuweisen, daß keine signifikanten Unterschiede erreichbar sind.
Zwischen den Raw-Konvertern von Adobe und von Phaseone sind bzgl. erreichbarer Qualität keine Unterschiede festzustellen.
Die dng-Formate von Adobe Lightroom und Capture One sind nicht kompatibel, d. h. das, was Adobe anstrebt, eine Vereinheitlichung der Raw-Formate, wird von Capture One nicht unterstützt, Capture One geht eigene Wege.
Also entweder Adobe Lightroom oder Phaseone Capture One verwenden, gemischt zu verwenden kann ich nicht empfehlen.